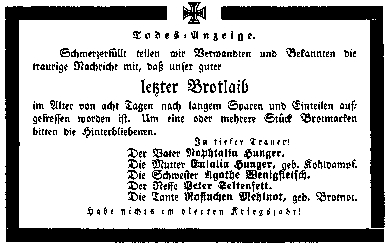|
|
|||||||||||
|
Der Erste Weltkrieg (5)
Die „Heimatfront“
- Von der Nahrungsmittelknappheit zur
Hungerkatastrophe
An der sogenannten Heimatfront
war von der neuen Härte des Krieges, der sich
ja vorwiegend im Ausland abspielte nicht viel zu
spüren – abgesehen von
Schicksalsschlägen wie der Tod eines geliebten
Angehörigen, Verwandten oder Freundes. Doch
auch dort hat der Krieg seine drastischen Spuren
hinterlassen.
Bereits am 13. August 1914
gründete das Preußische
Kriegsministerium (KRA) durch Walther Rathenau eine
spezielle „Kriegsrohstoffabteilung“. In
der Woche vom 18. bis 24. Januar 1915 fand eine
erste „Reichswoche“ statt, in der zur
Sammlung von warmer Unterkleidung für die
deutschen Truppen aufgerufen wurde und am 25.
Januar riet der Deutsche Bundesrat zu sparsamem
Nahrungsmittelverbrauch.
Da diese Maßnahmen aber
nicht ausreichten, beschloss der Bundesrat am 13.
Februar die Beschlagnahme der Hafervorräte und
am 25. Februar die Einschränkung des zu jener
Zeit noch recht geringen Autoverkehrs, um Rohstoffe
zu sparen. Am 23. Juli sollte eine
„Verordnung gegen Preiswucher bei
Lebensmitteln“ den Markt für die
Bevölkerung beruhigen (Im Vergleich zum
Vorjahr hatten sich die Preise aber bereits
verdoppelt). Die Hilflosigkeit der Regierung
offenbart sich aber im November, als der Bundesrat
am 4. des Monats Höchstpreise sowie ein
Verkaufsverbot von Milch und Fleisch an Dienstagen
und Freitagen beschließt, um Wucher und
Überteuerung einen Riegel vorzuschieben. Sechs
Tage später werden Höchstpreise für
Gemüse, Obst und Honig eingeführt und in
Berlin werden am 15. November erstmals
Der neue Kriegskredit von 10
Milliarden Reichsmark, den der Reichstag am 20.
August 1915 verabschiedet, macht jedem deutlich,
dass der Krieg für die Bevölkerung nicht
nur immer teurer wird, sondern sich zunehmend
einzurichten beginnt. Am 1. September wird der
„Deutsche Künstlerhilfsbund“ zur
Unterstützung heimkehrender Künstler
gegründet.
1916 setzten sich die
Maßnahmen fort. Am 22. Mai wird ein
Kriegsernährungsamt zur Sicherstellung der
Lebensmittelversorgung gegründet. Am 30. des
Monats wird in Preußen die Einkommenssteuer
erhöht und am 1. Juli im ganzen Reich die
Tabaksteuer (Zigaretten verteuern sich um 100
Prozent). Am 1. August folgen die Post- und
Telegraphengebühren, die um bis zu 50 Prozent
angehoben werden.
Am 10. Juli war in Berlin
bereits eine Großküche eingerichtet
worden, die täglich 30.000 Menschen mit warmem
Essen versorgen konnte. Am 2. Oktober wird die
Reichsfleischkarte (250 g pro Woche) im ganzen
Reich eingeführt und nur 12 Tage später
tritt eine neue Verordnung für die
Kartoffelversorgung tritt in Kraft (750 g pro Tag).
Weitere 12 Tage später, am 26. des Monats,
legt angesichts der Engpässe in der
Kartoffelversorgung das Kriegsernährungsamt
Erzeuger-Höchstpreise für Rüben und
Möhren fest. Am 4. Dezember werden alle im
Deutschen Reich vorhandenen Kohlrüben zur
„Sicherung der Volksernährung“
beschlagnahmt („Kohlrübenwinter“).
Die anhaltende Hungersnot lässt die Regierung
am 17. Februar 1917 in Berlin ein Ministerium
für Lebensmittelversorgung bilden. Die
schlechte Ernährungslage zwingt die
Kriegsernährungsstelle am 3. März in
Dosen konserviertes Gemüse frei zu geben (1 kg
pro Lebensmittelkarte). Doch am 1. April folgen
weitere Kürzungen. So werden die Brotrationen
auf 170 g pro Person und Tag und die
Kartoffelrationen auf 2.500 g pro Woche
gekürzt.
Am 20. Februar 1917 werden
Fünf-Pfennig-Münzen aus Kupfer für
Kriegszwecke eingezogen und durch solche aus
Aluminium ersetzt. Am 24. Februar 1917 werden wegen
des Kohle- und Holzmangels in Berlin sämtliche
Schulen geschlossen. Erste Fälle von Pocken
und Hungertyphus werden verzeichnet. Um die Moral
an der Front nicht gänzlich zu zerstören,
erscheinen am 2. März in der deutschen Presse
Aufrufe, keine sogenannten Jammerbriefe an die
Front zu senden. Am 16. Mai 1918 kürzt das
Kriegsernährungsamt in Berlin die
tägliche Brotration auf 150 g pro Person und
Tag.
1917/18 Das vierte Kriegsjahr
oder„Wir haben jetzt die Schnauze
voll!“
Während die russische
Revolution ab Februar 1917 Entlastung im Osten
brachte, kam mit dem Kriegseintritt der USA im
April 1917 aufgrund der deutschen Erklärung
des uneingeschränkten U-Boot-Krieges die
entscheidende Kriegswende. Damit waren alle
Bemühungen der Reichsleitung, durch die
Vermittlung des amerikanischen Präsidenten
Wilson zu Friedensverhandlungen zu kommen, dahin.
Ludendorff hatte zwar die durch Falkenhayn
verursachte verfahrene militärische Lage
verbessern können, doch der Verschiebung des
Kräfteverhältnisses zugunsten der
Alliierten konnten die deutschen Truppen nichts
gravierendes entgegensetzen. Ludendorffs
strategischer Rückzug auf die
Siegfriedstellung im März 1917 brachte zwar
kurzfristige Vorteile, konnte die Niederlage aber
nicht verhindern.
Die Kriegsverbrechen der
„verbrannten Erde“ bei dem Rückzug
charakterisierten die Situation Deutschlands an der
Front und die durch den Wechsel in der OHL
beförderte Ausschaltung der zivilen
Reichsregierung und den Sturz des Kanzlers
Bethmann-Hollweg im Reich. Deutschland war quasi
zur Militärdiktatur geworden. Die
Kriegsmüdigkeit in der Heimat wurde ebenso
wenig wahrgenommen wie die Desillusionierung der
Mannschaften an der Front und die allgemeine
Friedenssehnsucht.
An der Westfront unternahmen
die Alliierten 1917 mehrere Großoffensiven.
Ein Durchbruchsversuch der Engländer
scheiterte in der Schlacht bei Arras (2. April bis
20. Mai) und einer bei ihren Offensiven im Artois
(28. April bis 20. Mai) sowie in Flandern (27. Mai
bis 3. Dezember). Ebenso erging es den Franzosen in
der Doppelschlacht an der Aisne und in der
Champagne (6. April bis 27. Mai). Es kam zu
Meutereien in der französischen Armee.
Nivelles wurde durch Pétain abgelöst.
Der erste Einsatz von Tanks
durch die Engländer in der Schlacht von
Cambrai (20. November 1917) wirkte sich auf die
deutschen Truppen demoralisierend aus, sie hatten
dem nichts entgegenzusetzen. Ludendorffs flexiblere
Angriffsweise half da nur wenig. Drei
Großoffensiven im März/April 1918
südlich von Ypern, zwischen Arras und Reims,
blieben wieder einmal stecken. Eine letzte Hoffnung
der Soldaten auf ein baldiges Kriegsende schien
dahin, Durchhalteparolen wurden zunehmend
wirkungslos. Die Truppe war desillusioniert und
kriegsmüde und es kam zu vereinzelter
Befehlsverweigerung.
Am 18. Juli begann die
alliierte Gegenoffensive, erstmals unter einem
gemeinsamen Oberbefehl unter General Ferdinand
Foch. Das Eintreffen der Amerikaner brachte den
Alliierten ein deutliches Übergewicht,
die Schlacht bei Amiens vom 8. bis 11. August
mit 450 Tanks einen tiefen Durchbruch. Ludendorff
sprach vom „schwarzen Tag des deutschen
Heeres“. Die deutsche Widerstandskraft war
gebrochen.
1918/19 Revolution oder
„Wir wollen nach Hause!“
Spätestens Ende September
1918 war klar, dass der Krieg für das Deutsche
Reich nicht zu gewinnen war. Da die Entente nur mit
einer demokratisch legitimierten Regierung
verhandeln wollte, blieb der Generalität
nichts weiter übrig, als dem nachzugeben.
Trotzige Versuche, sich den Bedingungen der
Alliierten zu entziehen, führten u.a. am 20.
Oktober zu einem Befehl an die deutsche
Hochseeflotte eine erneute Großoffensive zu
starten. Doch, das Maß war voll und nur sechs
Tage später meuterten die Matrosen in
Wilhelmshaven und kurz darauf in Kiel. Überall
in Deutschland bildeten sich Arbeiter- und
Soldatenräte, die eigentlich nur
Soldatenräte waren. Am 7. November kam es zur
Revolution in München. Am 10. November wird
Wilhelm II fahnenflüchtig und setzt sich nach
Holland ab.
|
|
||||||||||
|
|
|
| |||||||||