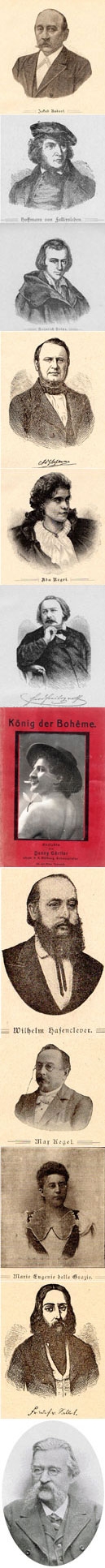Eduard Sõrmus
Julius Eduard Sõrmus (in Deutschland: Soermus; * 9. Juli 1878 in
Luunja; † 16. August 1940 in Moskau) Der estnische Violinist
studierte Geschichte und Philosophie in Tartu und Geige am
Konservatorium Petersburg. Seit der Jahrhundertwende engagierte er sich
für den Kommunismus und wurde als Der
rote Geiger bekannt. Er war 1905 an
der russischen Revolution beteiligt.
Seine Laufbahn als Violinist begann 1904. Nachdem
er 1906 aus dem zaristischen Russland fliehen musste, unternahm er
Konzertreisen durch Nordeuropa. Später studierte er in Berlin bei
Henri Marteau und in Paris bei Lucien Capet. Seine musikalische
Aktivität spielte sich hauptsächlich in Deutschland ab. In
erster Linie beteiligte er sich in der Weimarer Republik an
Veranstaltungen der KPD, der Internationalen Arbeiterhilfe und der
Internationalen Roten Hilfe. In seinen Konzerten wurde er häufig
von seiner Frau, der Pianistin Virginia Tschaikowski-Sõrmus
begleitet. Auch wird 1932 die Pianistin Olga Scheitkowski in der
kommunistischen Hamburger Volkszeitung (HVZ) vom 26.11. erwähnt,
als die Zeitung berichtete, man hätte ihm „die
Einreiseerlaubnis verweigert“.
Im September 1926 schrieb der Pfälzische Bote
über Sõrmus:
„Unerhörtes wagt Soermus, er spricht
vor jedem Stück zum Publikum und erklärt kurz den Inhalt. Mit
seiner weichen sympathischen Stimme schildert er in kurzen Strichen
Bach, Händel und Beethoven, die größten Komponisten
Deutschlands und der Welt. Wie liebt er sie“ Wie schlicht macht
er den Zuhörern die Begriffe „Allegro“,
‚Adagio’ usw. klar. Wie empfindet er Beethovens tiefes
Leid, Paganinis dämonische Gewalt. So kommt es, daß seine
Zuhörer – zum größten Teil Arbeiter und
Mittelstand, die Unterdrückten, denen des Künstlers Liebe und
Anteilnahme gehört – seine Musik verstehen. Sie, die selten
oder nie in den Konzertsaal kommen, ahnen Bachs Größe, sie
spüren die nie gestillte Friedenssehnsucht in Händels
‚Largo’ und Beethovens lebensbejahende Freude im
‚Menuett’ und im ‚Türkischen Marsch’
…“ (Zitiert nach Horst Benneckenstein, in: MuG, 1967, Heft
9, S. 584.)
Es gibt einige Geschichten über bzw. zu dem
„Geiger der Revolution“. Leider fehlen meistens die
Quellenangaben. So kann man bei Traude Ebert und heute bei Wikipedia
lesen, dass Sõrmus am 1. Mai 1923 im Kristall-Palast Magdeburg
„von der Polizei verhaftet“ wurde, „weil die
Behörden aufgrund seiner politischen Betätigung das Visum
annulliert hatten“. Dabei soll „seine wertvolle
Vitaszek-Geige zerstört“ worden sein. Und um die Geschichte
komplett zu machen, hätten „Schüler und Lehrer des
Leipziger Konservatoriums“ ihm „eine neue kostbare
Violine“ gespendet. Nun, wenn die wirklich „kostbar“
war, fragt man sich natürlich, wo kam das Geld tatsächlich
her? Es soll auch noch 1975 am Kristall-Palast eine Gedenktafel
angebrachte worden sein.
In Hamburg führte sein Ansehen, dazu, dass
sich 1926 ein Streichorchester bildete, dem sie den Namen
„Arbeiter-Musikvereinigung ‚Soermus’“ gaben.
Zum einjährigen Jubiläum schrieb die HVZ am Montag, den 18.
Juli 1927:
Achtung, Arbeitermusikanten!
Arbeiter, Angestellte, Klassengenossen!
Ein Jahr ist bereits ins Land gegangen, seidem
sich das aus revolutionären Arbeitern zusammengesetzte
Streichorchester, die Arbeiter-Musikvereinigung
„Soermus“ gebildet hat.
Bisher waren es nur wenige Genossen, die ihr ganzes Können in den
Dienst der Bewegung stellten, doch jetzt ist es an der Zeit, auch die
Öffentlichkeit zu interessieren. „Soermus!“ Wer kennt
nicht den roten Geiger. Viele Zehntausende Arbeiter hatten das
Glück, in den Genuß eines Konzertes zu kommen, wo unser
roter Geiger mit sicherer Hand fesselnde Töne zu meistern
verstand. Alle, die ihn kennen, wissen, daß er ein Meister der
Geige ist. Wem klingt nicht das Stöhnen vom Wolgaufer in den
Ohren? Alles das hat der Meister den Arbeitern und Klassengenossen die
tagsüber schwer arbeiten müssen, auf seiner Geige
hervorgezaubert. Auch wir wenigen Genossen, die den festen
Entschluß gesetzt haben, durch Musik dem ermüdeten Arbeiter
ein paar schöne Stunden zu bereiten, wissen, welchen Weg uns unser
Meister Soermus durch sein Spielen gezeigt hat.
Wir fordern, da allein zu schwach, alle Arbeiter
und Genossen, die irgendein Streichinstrument oder Flöte, Posaune,
Trompete, Klavier, Klarinette usw. spielen können, auf, sich uns
anzuschließen. Gemeinsames Wirken wird erfreuliche Arbeit zutage
fördern! Wir wollen den Proletarier über schwere Stunden
hinweghelfen. Doch auch zum Kampf werden wir es durch die Musik
anfeuern. Darum ersuchen wir nochmals alle Interessierten, die geneigt
sind, unsere Sache zu unterstützen, sich in den untenstehenden
Lokalen zu melden. Übungsabende: Mittwoch 20 Uhr bei Riesler,
Hamburg, Feldstr. 49; Donnerstags 20 Uhr und Sonntags 11 Uhr bei Banke
Hamburg Kohlhöfen 23.
Von 1926 bis 1930 war die Musikvereinigung an
vielen Veranstatlungen der KPD und seiner Vorfeldorganisationen
beteiliegt. Eine Meldung in der HVZ vom 18.2.1930 deutet darauf hin,
dass das Orchester aufgrund mangelnder Mitspieler seine Aktivität
einstellen musste. Dort heißt es „Achtung, Musikfreunde!
Das Streichorchester ‚Soermus’ benötigt noch einige Musiker (innen) mit
Notenkentnissen. Anmeldung bei Willi Bauke, Kohlhöfen 28.“
Sõrmus’ besonderes Engagement galt
Kindern und Kinderheimen, z. B. in Elgersburg und Worpswede. In
Hamburg wurde, nachdem er die Hansestadt des Öfteren besucht
hatte, in seinem Namen nicht nur ein Orchester gegründet.
Ein Beispiel aus Hamburg zeigt auch hier die
Auswirkungen des Geigers. Am 20. Oktober 1928 heißt es in der
HVZ:
„Arbeiter Streichorchester
‚Soermus’“
Die kleinen Kinder dürfen nicht
hungern“, sagte der Genosse Soermus, der „rote
Geiger“, als er in Hamburg spielte.
„Solidarität“ ist die praktische Waffe der
Arbeiterschaft im Kampfe gegen den Kapitalismus. So hat der Genosse
Soermus die Last auf sich geladen, 200 Kinder, denen der Ernährer
geraubt ist, durch sein Spielen zu erheitern. Er appellierte besonders
an die Arbeiterklasse, ihre Pflicht zu tun und das Los der Mütter
im Haus und der Klassenkämpfer hinter den Gefängnis- und
Zuchthausmauern zu erleichtern. Jeder Arbeiter und refolutionäre
Kämpfer sollte sich diese Worte zu Herzen nehmen und danach
handeln.
Die Sorge des gefangen gehaltenen Familienvaters
wird nicht so schwer sein, wenn er weiß, daß seine Genossen
und Mitkämpfer, die noch die Freiheit genießen, seine
Angehörigen nicht verlassen. So fand am Montag, den 10. Oktober,
im Holsteinischen Haus“ ein Konzert zugunsten der Witwen und der
Kinder des bei den Geesthachter Wahlen erschossenen Mitgliedes der
Roten Marine Heinrich Rüssel statt.“ [In der HVZ stand
tatsächlich „Wirwen“ im Plural]
(Die hier angesprochene Auseinandersetzung in
Geesthacht fand am Sonntag, den 30.9.1928 zwischen dem Roten
Frontkämpferbund und dem sozialdemokratisch geprägten
Reichsbanner statt. Es bag dort zwei Tor und über 200 teilweise
schwer Verletzte. – Siehe dazu: Werner Hinze, Bluttage]
Am 17. und 21. Februar 1929 gab Sõrmus zwei
Konzerte zugunsten der Kinderheime der RHD (HVZ vom 24.1.1929, S. 3).
Und nach der Aktivität des „Streichorchesters
‚Sõrmus’“ entstand ab ca. August 1931 ein
Streichorchester „Jung-Sõrmus“ für Kinder und
Jugendlichen aus dem Umfeld des „Verbandes proletarischer
Feidenker Bezirk Wasserkante-Nordwest“. Veranstaltungen der
Gruppe sind bis November 1932 in der HVZ dokumentiert.
Eine Aufnahme von Sõrmus
(„Unsterbliche Opfer“ aus dem Jahr 1918 befindet sich auf
der CD: Brüder, zur Sonne, zur Freiheit. Arbeitermusik der
Weimarer Republik in Originalaufnahmen. PLÄNE 88775, LC 0972.
Literatur:
Traude Ebert, Das Verhältnis der
Arbeiterklassen zur Instrumentalmusik, dargestellt bis zum Jahre 1933.
Dissertation / zur Erlangung des akademischen Grades doctor
philosophiae (Dr. phil.) von Dipl.-Phil. Traude Ebert., Berlin 1971
Inge Lammel, Arbeitermusikkultur in Deutschland
1844-1945, Leipzig 1984,
Werner Hinze, Bluttage. Ein Beitrag zur
„Wahrheitsfindung“ oder Vom „Hamburg-Aufstand“
der KPD zum „Altonaer Blutsonntag“, Hamburg und Rom 2013.