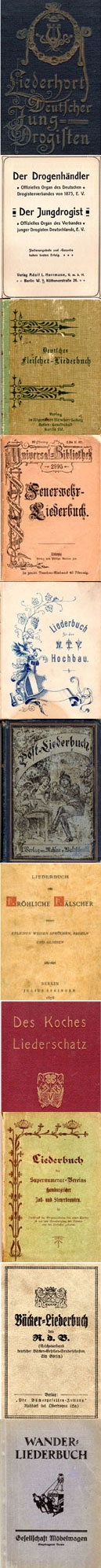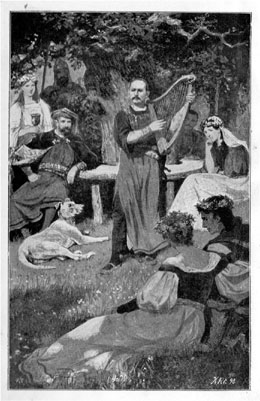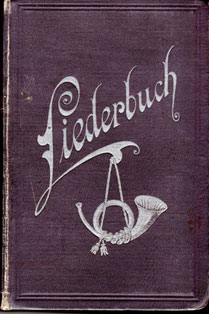Der Verband Deutscher
Postassistenten bzw. Verband Deutscher Post- und Telegraphen-Assistenten wurde am 6. Juni 1890, also nach dem Fall der
Sozialistengesetze, gegründet. Er war die älteste
Vorgängerorganisation der Deutschen Postgewerkschaft. Allerdings
wie man dem Vorwort und dem Inhalt schnell anmerkt, hatte er nicht viel
mit der damaligen organisierten Arbeiterbewegung zu tun.
1898 gründete sich der Verband Deutscher Post- und Telegraphen-Unterbeamten Vereine, 1900 die Vereinigung der
höheren Reichspost- und Telegraphenbeamten und 1907 der Bund der Inspektoren
und Amtmänner der Deutschen Reichspost.
Hinzu kam 1912 der Verband Deutscher
Reichspost- und Telegraphenbeamtinnen.
Das vorliegende Liederbuch war die erste uns
vorliegende musikalische Ausdrucksformen der noch neuen kaisertreuen
Gewerkschaft. Es erschien mit 698 Seiten (teilweise mit Noten) in
Berlin, im Selbstverlag des Verbandes – gedruckt von Anton
Bertinetti , Brunnenstrasse 10, Berlin N. Als Herausgeber und Verfasser
des Vorwortes zeichneten Schubert (Berlin) und Grothe-Kaldenkirchen
(Rheinland).
Die Vorderseite schmückt in
Silberprägung den Titel (Liederbuch) und ein Posthorn. Die
Rückseite ist mit einer Blindprägung eines Reichsadlers
versehen. Vorangestellt wurde der folgende Spruch:
„Das Wort sei frei
das Herze treu
einig und gleich
treu Kaiser und Reich“
Der Inhalt besteht aus zwei Teilen:
Beigelegt ist ein Druckfehlerverzeichnis
In ihrem Vorwort geben die Herausgeber einen
kurzen Abriss der Entwicklung des Verbandes und ihrer kulturellen
Grundidee. So sei seit der Gründung im Sommer 1890 die
„vornehmste Aufgabe“ die „Pflege edler
Geselligkeit“ und „wahrer Kameradschaft“. Positives
habe es gegeben
Als im Sommer 1890 der Verband Deutscher Post- und
Telegraphen-Assistenten gegründet wurde, stellte er als eine
seiner vornehmsten Aufgaben die Pflege edler Geselligkeit, wahrer
Kameradschaft auf. Wir können, ohne den Vorwurf des Eigenlobs
fürchten zu müssen, mit vollem Recht sage, daß unsere
Vereinigung mit allen Kräften und unverkennbarem Erfolge diesem
einen ihrer Ziele nachgestrebt hat; die „wohlgelungenen
festlichen Veranstaltungen, die Versammlungen und Kommerse der
Mitglieder selbst sowohl, wie die Feiern in Gemeinschaft mit ihren
Angehörigen und Freunden, patriotische Feste ebenso, wie gesellige
Zusammenkünfte in kleinem Rahmen“. Damit sei der erfreuliche
Beweis geliefert worden, dass „der echte deutsche Geist, der
seine freudige Bethätigung in der Geselligkeit findet, in unserem
Verbande verständnißvolle und erfolgreiche Förderung
und Pflege erfahren“ habe. Eine Steigerung der
Deutschtümelei findet sich in dem Satz: „wie die Volksseele
ihre Schwingungen im Liede wiederspiegelt.
Bereits kurz nach der Gründung des Verbandes
seien in den Untervereinen eigene Lieder und kleine Sammlungen
entstanden. Bei der Herausgabe des jetzigen Liederbuches wollte man
sich keine allzu großen Beschränkungen bezüglich Umfang
auferlegen. „der Inhalt mußte einen solchen Umfang haben,
daß alle anderen Liederbücher für und entbehrlich sein
würden“.
Daraus schlossen die Herausgeber, dass die neue
Liedersammlung „eine Auswahl und Zusammenstellung der beliebteren
deutschen Lieder“ beinhalten müsse. Sie müsse
daher über „möglichste Reichhaltigkeit und
Vielseitigkeit“ verfügen. Da man Rücksicht „auf
die Bedürfnisse geselliger Familienkreise“ nehmen wolle,
seien auch „bekannt und beliebte Operntexte ausgewählt
worden“, während „Kriegs- und Studentenlieder nur
Aufnahme gefunden, soweit sie zum Gemeingut unseres Volkes
geworden“ seien.
Dem Volksliede sei „der breiteste Raum
gelassen“ worden. „Der Eigenart postalischer
Geselligkeit“, womit die Regionen gemeint waren, sollte Rechnung
getragen werden, so dass
„fast alle[r] deutschen Gaue
vertreten“ seien und die Abteilung III Heimatlieder
umfangreich werden konnte.
Lieder, „die in konfessioneller oder
sittlicher Beziehung Anstoß erregen könnten“, seien
ausgeschlossen worden.
Anfangs hatte man offensichtlich vor, „nur
Verbands- oder Berufslieder zu sammeln“, andere allgemeiner
gehaltenere sollten ausgeschieden werden. Doch, da das Buch sich auch
„in unseren Familienkreisen … einbürgern“
sollte, wurden die Grenzen erweitert.
Und nun kam doch etwas unerwartet politisches, so
heißt es
„Ferner sollte das Buch von unseren
Fähigkeiten und dem Geistesleben in unserem Stande Kunde
geben“. Die Schranke, die uns äußerliche mit rauer
Rücksichtslosigkeit einst gezogen worden ist, wir lassen sie
für unser Innenleben nicht gelten, wir wollen jederzeit zeigen,
daß das Niveau unserer Bildung nicht unter ihr liegt. Mag auch
die Mehrzahl der aus unseren Reihen hervorgegangen Lieder zu den
sogenannten „Gelegenheitsprodukten“ gehören, mag auch
der spröde Stoff zuweilen die poetische Form beeinträchtigt
haben, die zum Ausdruck gekommenen Gedanken gehen doch wohl über
den beschränkten Gesichtskreis hinaus, der uns zugewiesen ist.
Nach der Benennung einiger Personen, die einen
Anteil am Zustandekommen des Liederbuchs hatten, werden auch noch die
Frauen erwähnt. Hier der original Ton:
„Am Schlusse ist Raum für
Nachträge gelassen worden. Den Anfang dafür bilden schon
einige, während des Druckes noch zugegangene Lieder, verfasst von
Fernsprechgehülfinnen, die sowohl dem Verbande, als auch dem
Liederbuche ein großes Interesse entgegengebracht haben. Nicht
allein die engen dienstlichen, sondern auch die verwandtschaftlichen
Beziehungen zu Kameraden (ganz abgesehen von den Geboten der
Höflichkeit und Galanterie), sollten für uns bestimmend sein,
diese Kolleginnen stets als willkommene Ehrengäste in unsere Mitte
aufzunehmen. In diesem Sinne und um der Berechtigung der Frauenbewegung
ein gewisses Zugeständniß zu machen, sind die Lieder
aufgenommen worden.“
Unterzeichnet habe die Herausgeber Schuber –
Berlin und Grothe – Kaldenkirchen (Rheinland).
I: Theil Auswahl deutscher Lieder (S. 1 – 323),
1. Vaterlandslieder (S. 3-48),
2. Volkslieder (S. 53-11),
3. Heimatlieder (S. 115-167),
4. Abschiedslieder (171-187),
5. Natur- und Wanderlieder (191-217),
6. Trinklieder (221-280),
7. Postlieder (285-298),
8. Lieder verschiedenen Inhalts, Operntexte u. s.
w. (S. 301-323)